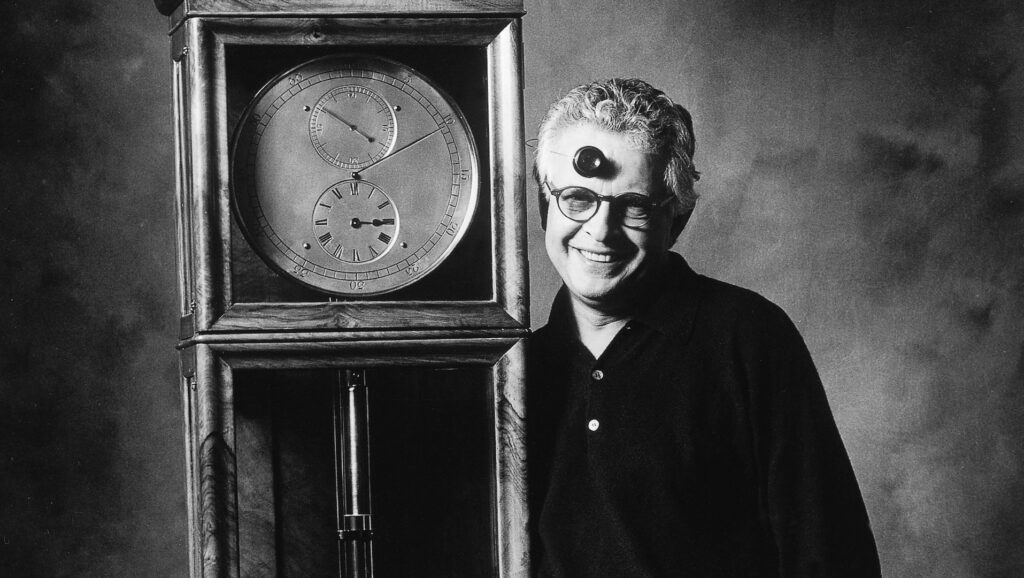Patek Philippe: Minutenrepetition Alarm Referenz 1938P-001Geschenk zum 85. Geburtstag
Eine große Geste für den Vater: Zum 85. Geburtstag von Philippe Stern, Ehrenpräsident von Patek Philippe, hat sein Sohn eine besondere Uhrenedition auflegen lassen – die Minutenrepetition Alarm Referenz 1938P-001