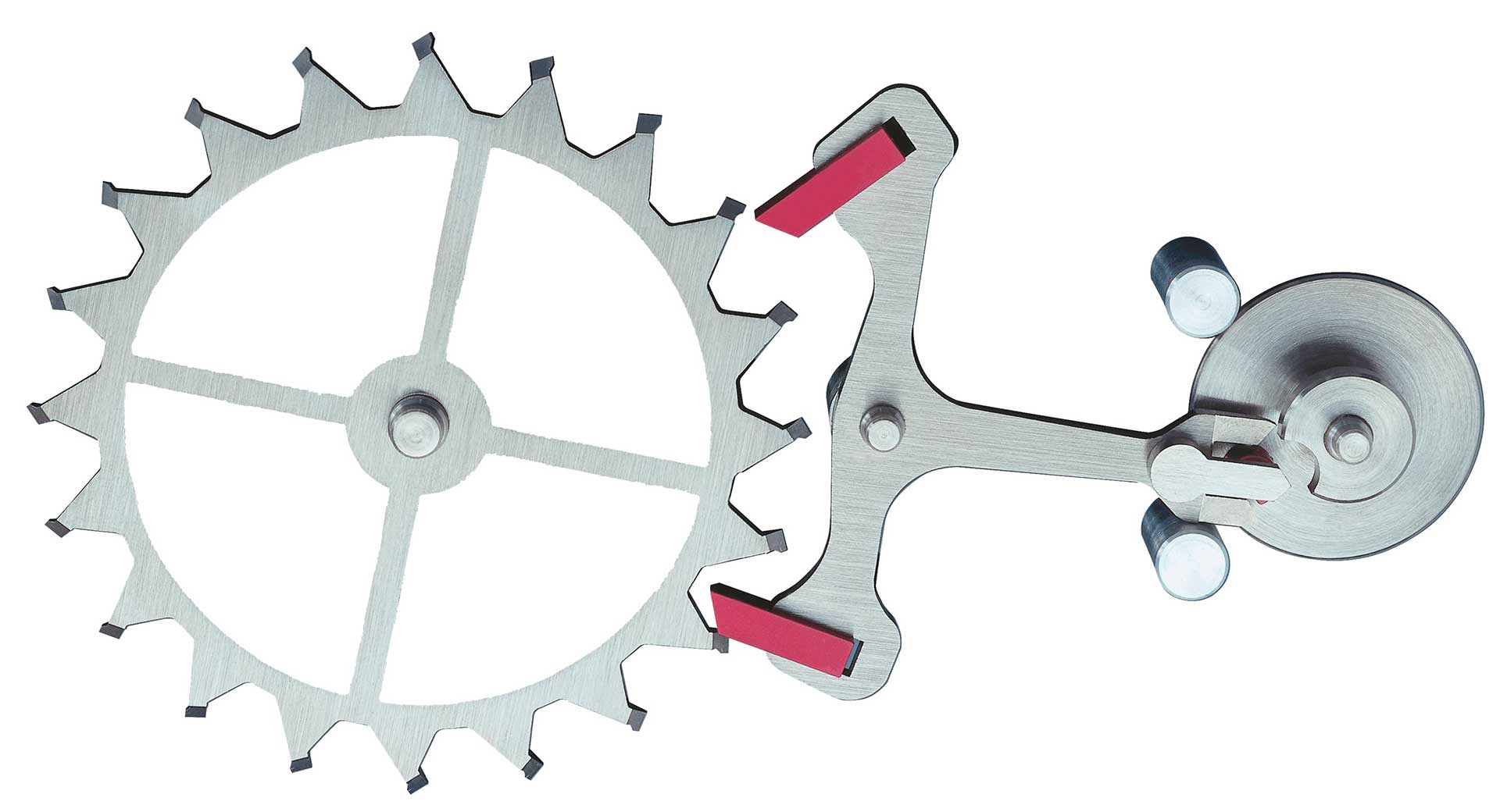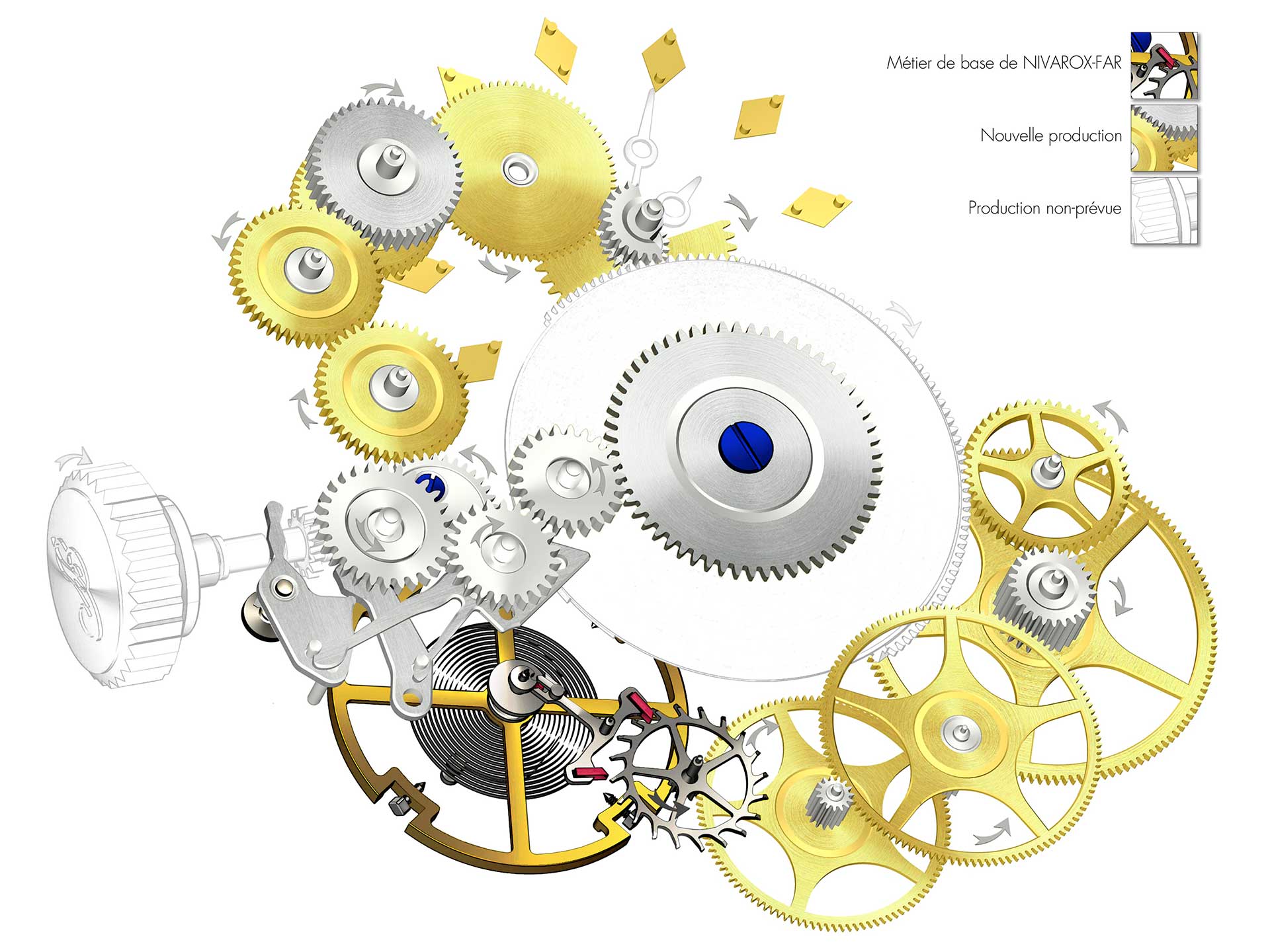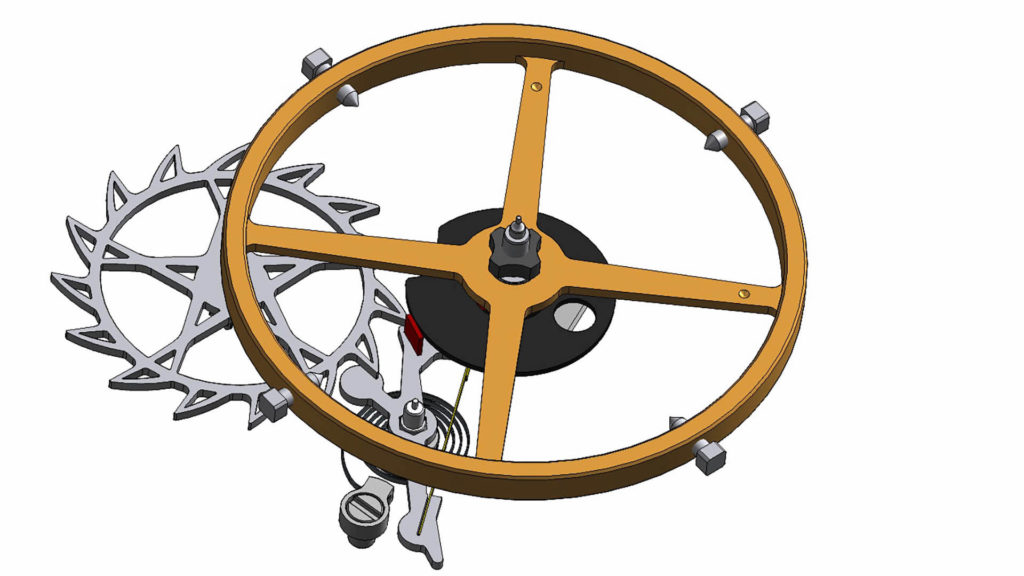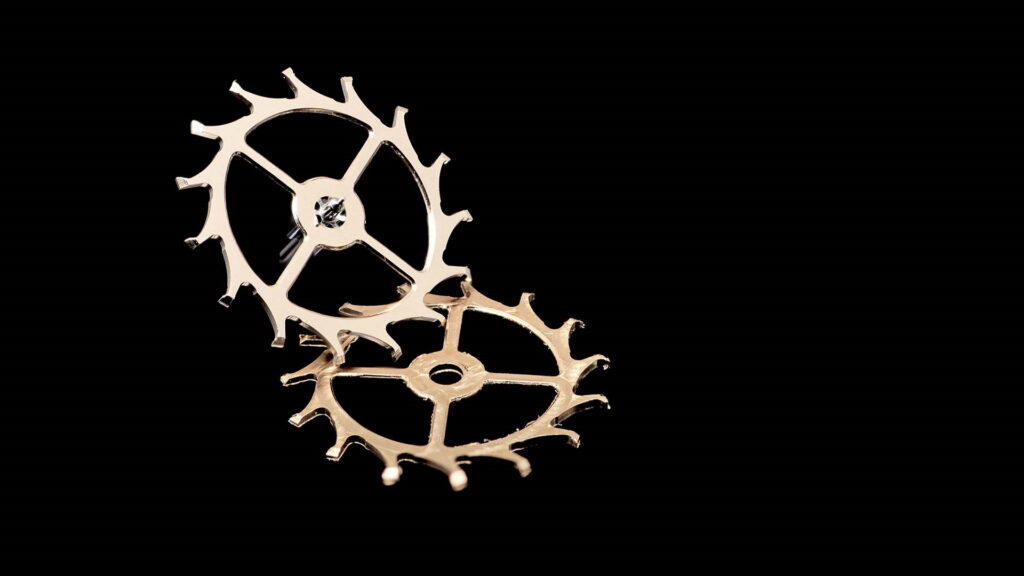25 Jahre ARMBANDUHRENTops und Flops der Uhrentechnik
Was wird aus den Meilensteinen der Uhrentechnik, die uns in schöner Regelmäßigkeit als das Neue und einzig Wahre präsentiert werden? Ein Rückblick auf Entwicklungen der vergangenen 25 Jahre und ihren tatsächlichen Werdegang.