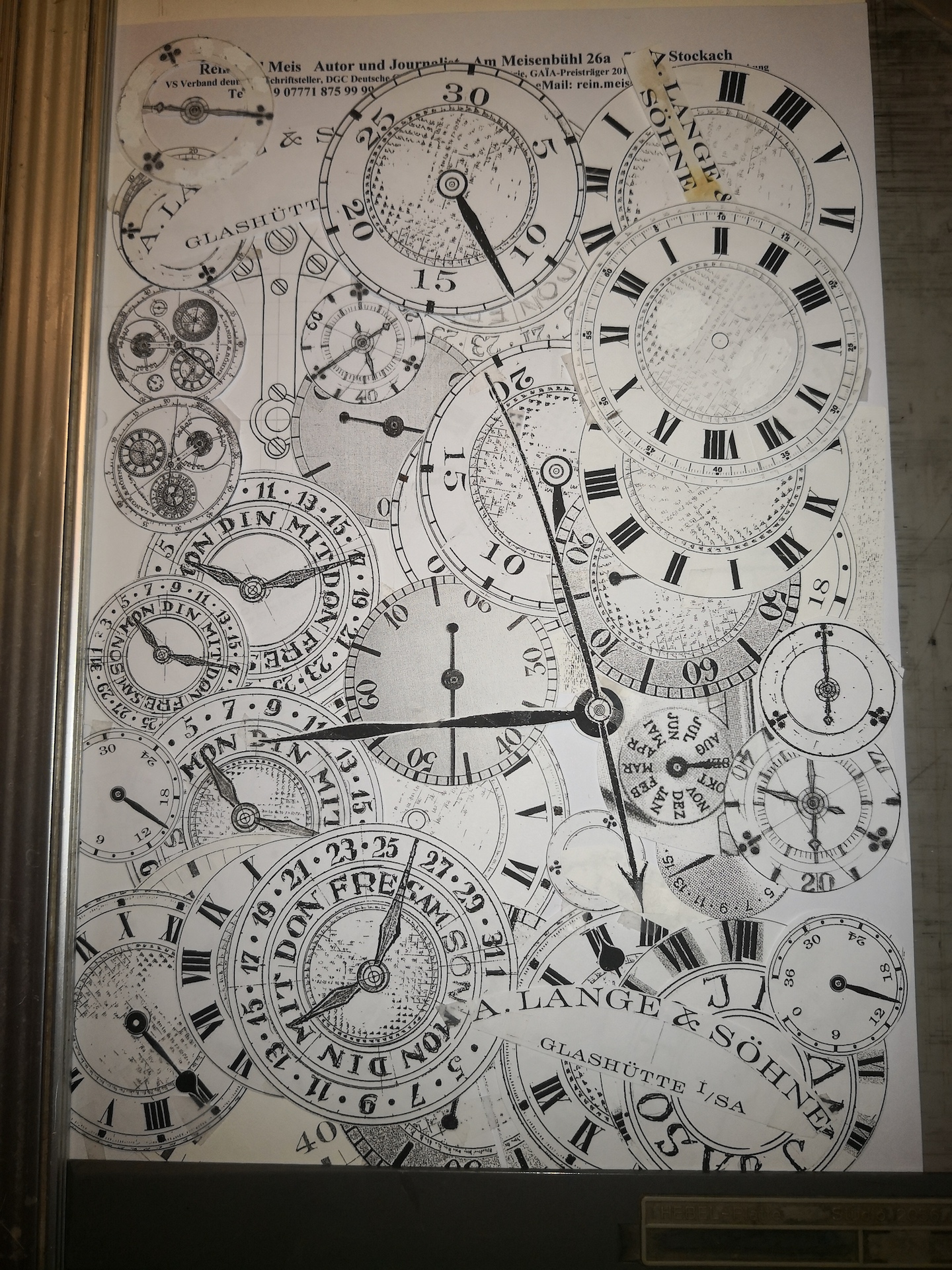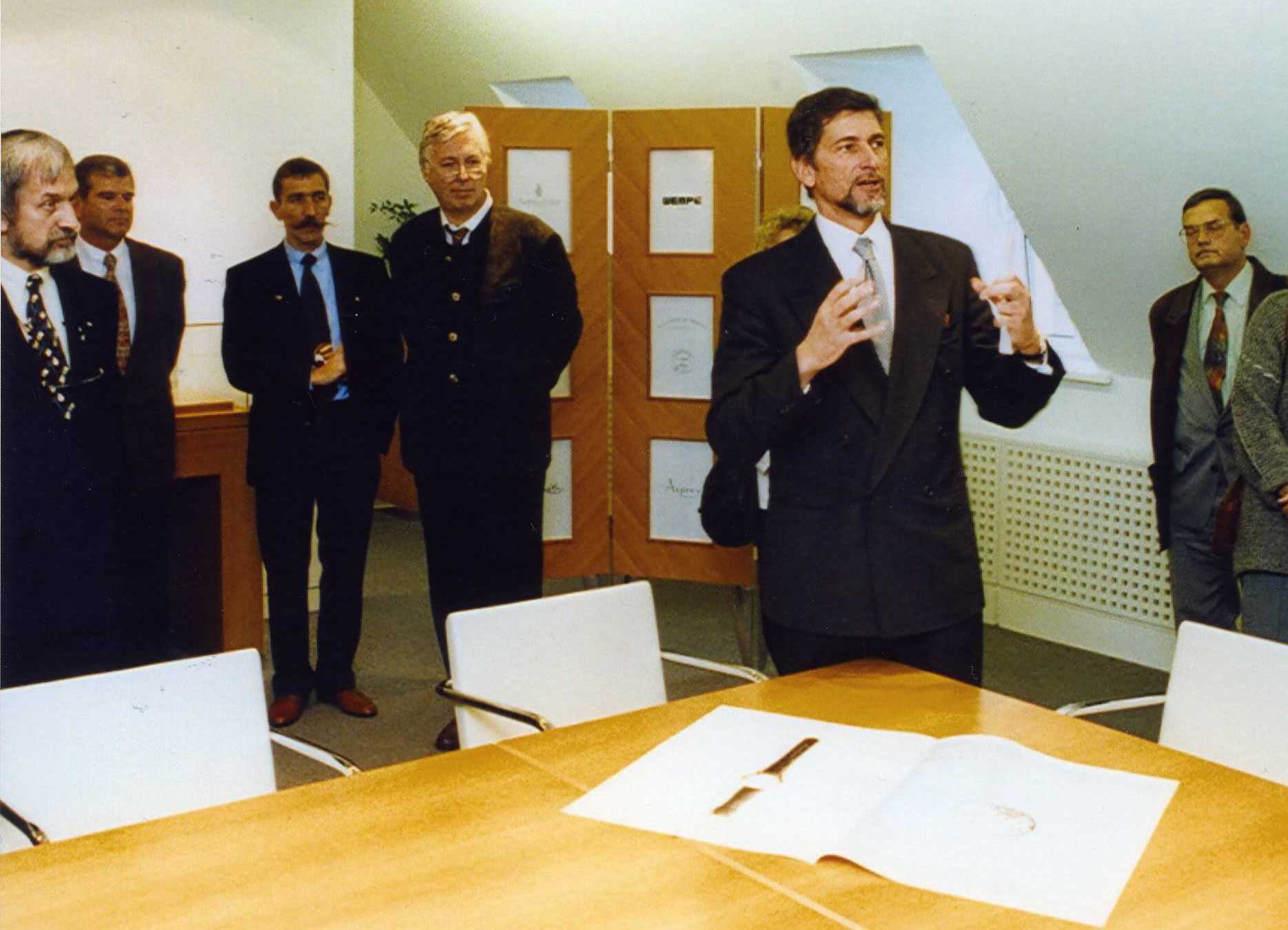Watches and Wonders 2023Die Neuheiten der Genfer Uhrenmesse
Auf dieser Seite finden Sie eine Sammlung der Neuheiten, die auf der Genfer Uhrenmesse Watches and Wonders vorgestellt werden. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Button, um mehr über das jeweilige Modell zu erfahren!